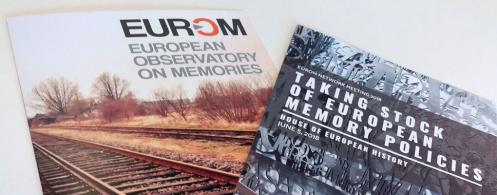
Sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, Jordi, liebe Kollegen von EUROM und den europäischen Institutionen, Universitäten, Museen und Verbänden, liebe Gäste,
erlauben Sie mir, Sie im Namen des Teams des Hauses der Europäischen Geschichte herzlich in unserem Haus zu begrüßen. Wir freuen uns sehr, heute Gastgeber dieser wichtigen Diskussion zu sein.
Diejenigen unter Ihnen, die bereits unsere Dauerausstellung besucht haben, wissen, dass wir den Begriff der Erinnerung als geeignetes Konzept verwenden, um Themen wie die Auswirkungen der Geschichte auf die Gegenwart, die Vielfalt der Erinnerungen an ein und dasselbe historische Ereignis, Erinnerungskonkurrenz und Erinnerungskonflikte zu behandeln.
Wir untersuchen auch die verschiedenen Arten des Umgangs mit schwierigen Vergangenheiten, zwischen später Anerkennung, Schweigen, Verdrehung von Tatsachen, langjähriger Verdrängung oder sogar Bestrafung derjenigen, die sich erinnern wollen. Die Erinnerung ist daher für uns ein wichtiges Instrument, um eine für Laien gemachte chronologische Geschichtserzählung durch eine kritische Reflexion über die Wahrnehmung der Vergangenheit aufzubrechen.
Gleichzeitig erläutern wir die "Funktionsweise" des Erinnerns und Vergessens anhand verschiedener Fallstudien. Wir zeigen, wie beide subjektiv sind, wie sie sich je nach Kontext verändern können, wie sie manipuliert werden können und wie Erinnerung zu motivierender Rache, aber auch zu Versöhnung führen kann.
Wie in unserem Leitbild festgelegt, möchten wir als Ort der Debatte dienen - um das Bewusstsein für unterschiedliche Wahrnehmungen gemeinsamer historischer Ereignisse zu schärfen und so letztendlich zu einem besseren gegenseitigen Verständnis bei der Bewältigung der Vergangenheit zu gelangen.
Aber gibt es überhaupt eine Chance, dass ein solcher gemeinsamer Ansatz gefunden werden kann? Ist es überhaupt möglich, sich auf eine Art der Geschichtsdarstellung zu einigen? Im ersten Jahr unseres Bestehens haben wir einige Kommentare erhalten, die, wenn man sie einander gegenüberstellt, in dieser Hinsicht interessant und aufschlussreich sind.
Lassen Sie mich nur zwei recht unterschiedliche Ansichten über unsere Ausstellung zitieren.
In einem Artikel mit dem Titel "Das Haus der Europäischen Geschichte und die Grenzen der Erinnerung"(1) kommentiert ein Besucher (Übersetzung durch das HEH):
